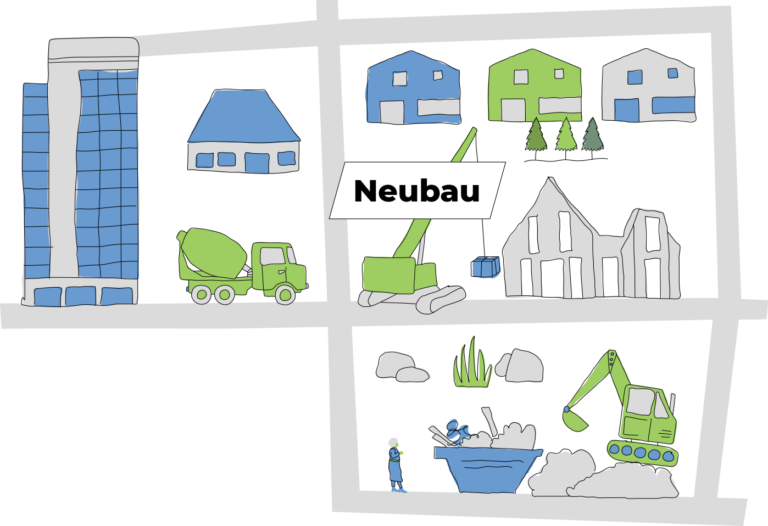Wassersensible Stadtentwicklung in der
Neuplanung
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) definiert mit § 55 die Zielvorgaben für den Umgang mit Niederschlagswasser: „Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, […].“ (§ 55 (2) WHG). Die Praxis zeigt, dass die Integration einer ortsnahen Bewirtschaftung in der Bauleitplanung nicht immer realisiert wird. Dabei bieten Neubaugebiete viele Möglichkeiten blau-grüne Infrastrukturen von Anfang an zu integrieren.
Potenziale für blau-grüne Infrastruktur bei Neuplanungen
In Neubaugebieten bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, blau-grüne Infrastrukturen bzw. eine blau-grüne Gestaltung umzusetzen. Dabei ist es zentral, die Ziele einer blau-grünen Stadtgestaltung bereits in der frühen Phase der Bauleitplanung, z. B. im Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes, zu integrieren und als erschließungstechnische Vorgabe für die Stadtplanung festzuhalten, insbesondere hinsichtlich des oberirdischen Flächenbedarfs von blau-grüner Infrastruktur. Eine weitere Qualifikation der Bebauungspläne hinsichtlich Biodiversitäts- und Klimaanpassungsziele kann auch über die Integration von Grünordnungsplänen in Bebauungsplänen erreicht werden.

Folgende entwässerungstechnische Ziele können beispielsweise festgesetzt werden:
- Niederschlagswasser sollte am Entstehungsort / auf jedem Grundstück bewirtschaftet werden (Versickerung, Verdunstung oder Nutzung). Damit wird das Wasser temporär zurückgehalten und Abflussspitzen in der Kanalisation vermieden.
- Die örtliche Wasserbilanz einer bisher unbebauten Fläche sollte auch nach ihrer Bebauung erhalten bleiben (Anteile an Verdunstung, Versickerung und Oberflächenabfluss).
Um die Aspekte der Hitzevorsorge und der Grünordnung sicherzustellen, sind außerdem ausreichend und unterschiedlich strukturierte Grünflächen vorzusehen. Diese sollen zum einen Kaltluftentstehung, Belüftung, Beschattung und Verdunstungskühlung sicherstellen. Zum anderen sollen sie einen Beitrag zur Biodiversität leisten, Freizeit- und Aufenthaltsqualität fördern und Begegnung ermöglichen.


Herausforderungen für blau-grüne Infrastrukturen bei Neuplanungen
Die größte Herausforderung ist es, die Belange der blau-grünen Stadtgestaltung im Planungsprozess zu gewichten und frühzeitig in die Überlegungen mitaufzunehmen. Aber auch technische und gestalterische Fragen sowie die Finanzierung der Anlagen stellen Hemmnisse dar.
Es bedarf einer fundierten Argumentationsgrundlage, die in jeder Planungsphase zu Rate gezogen werden kann, um alle Akteure von den Vorteilen einer klimaangepassten Entwicklung zu überzeugen und Flächenkonkurrenzen zu lösen. Wenn die Integration der Ziele der blau-grünen Stadtgestaltung nicht zu einer sehr frühen Phase der Planung gelingt, werden die Maßnahmen bei der Planung der Flächen meist kaum berücksichtigt. Auch bei einer multifunktionalen Nutzung bzw. Multicodierung von Freiflächen ist die Festschreibung schon im Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes ratsam. Multifunktionale oder multicodierte Flächen sind Flächen, die mehreren Nutzungsansprüchen gerecht werden und verschiedene Funktionen erfüllen: So kann beispielsweise eine Grünfläche oder ein Spielplatz gleichzeitig Versickerungsanlage oder Retentionsraum für Niederschlagswasser sein.
Weitere Hinweise zu den Herausforderungen und Möglichkeiten integrierter kommunaler Planung für eine blau-grüne Stadtgestaltung finden sich unter KOMMUNALE PROZESSE.
Weitere Herausforderungen ergeben sich aus verschiedenen Unsicherheiten hinsichtlich der Ausführung und Pflege blau-grüner Infrastruktur sowie rechtlichen Fragestellungen. Insbesondere im Zusammenhang mit multifunktionalen / multicodierte Flächen stehen häufig Fragen nach Haftung, Versicherung oder Unterhaltungsaufwendungen einer zügigen Umsetzung im Wege. Lösungen müssen für jeden Standort spezifisch gefunden werden, jedoch bieten bereits zahlreiche Materialien, Leitfäden und Regelwerke Unterstützung und klären auf: Einige sind hier und auf den entsprechenden Unterseiten genannt, z. B. unterstehende Beispiele aus Nordrhein-Westfalen und Bremen. Unter BESTAND und STRAßENRÄUME sind weitere wertvolle Umsetzungshilfen aus Berlin und Hamburg zu finden.
Ein wichtiges Argument gegen blau-grüne Infrastrukturen ist immer wieder die schwierige Finanzierung. Zum einen sind die Investitionskosten in der Regel höher als für „graue“ Infrastruktur, zum anderen sind die Unterhaltungskosten häufig ungeklärt, insbesondere bei öffentlichen Flächen. Lösungen für höhere Investitionskosten bieten umfangreiche Fördermöglichkeiten, z.B. über die Städtebauförderung des Bundes und der Länder oder auch über Programme zur Klimaanpassung. Für die Unterhaltung und Pflege der Anlage muss frühzeitig eine geeignete Regelung gefunden werden. Bei privaten Flächen sind die Zuständigkeiten meist klar, bei öffentlichem Grund muss die Stadtverwaltung intern Vereinbarungen treffen – von informellen Absprachen bis hin zu formalen öffentich-rechtlichen Verträgen (z. B. zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieben).
Handlungsoptionen für blau-grüne Infrastruktur bei Neuplanungen
Für konkrete Festsetzungen hinsichtlich wassersensibler Maßnahmen in der verbindlichen Bauleitplanung gibt es Möglichkeiten nach § 9 (1), (3), (5) BauGB. Siehe auch das Beispiel: Planerische Gestaltungsmöglichkeiten in der Bauleitplanung unten.
Zielbindungsverträge bieten die Möglichkeit für die vertragliche Vereinbarung wassersensibler Stadtgestaltung unter Beachtung der Vorgaben in § 11 BauGB – Städtebaulicher Vertrag.
In vorhabenbezogenen Bebauungsplänen können Inhalte über städtebauliche Verträge in Form eines Durchführungsvertrages festgeschrieben werden. Im Durchführungsvertrag können Investoren durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur Umsetzung wassersensibler Maßnahmen verpflichtet werden (§ 12 BauGB).
Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK) nach § 171b BauGB bilden die Grundlage für die Akquisition von Städtebaufördermitteln. Ziele eines solchen Konzeptes können gemäß § 1 (6) Nr. 11 BauGB in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung bei der Erstellung eines ISEK ist weitgehend offen und kann daher in die Richtung blau-grüner Stadtgestaltung entwickelt werden.
Mittels Stadtumbauverträgen mit beteiligten EigentümerInnen kann die Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungskonzepte erwirkt werden. Ein Vertrag kann Rückbaumaßnahmen und die Anpassung baulicher Anlagen innerhalb einer bestimmten Frist und die Kostentragung dafür (§ 171 c Nr. 1 BauGB) beinhalten, was jedoch die Bereitschaft von EigentümerInnen voraussetzt. Die Städtebauförderung des Bundes und der Länder nennt wassersensible Maßnahmen explizit als Fördergegenstand.
Die Gemeinde kann nach § 178 BauGB EigentümerInnen zur Bepflanzung ihres Grunds verpflichten. Demnach können Grünflächen auf Privatgrundstücken entstehen, welche das Potenzial für Verdunstungskühlung und Versickerung von Regenwasser vergrößern. Es gilt außerdem das Gebot zum Rückbau und zur Entsiegelung (§ 179 BauGB) von nicht mehr genutzten Flächen oder solchen Flächen, auf denen Gebäude stehen, die nicht mehr den Vorgaben aus dem B-Plan entsprechen. Die Gemeinde kann dieses Gebot vor allem nutzen, um die Leistungsfähigkeit beeinträchtigter Böden wiederherzustellen (§ 179 (1) BauGB).
Satzungen zur Gestaltung von Grundstücksfreiflächen
Für die Regelung örtlicher Vorschriften über die Gestaltung, Begrünung und Bepflanzung von Grundstücksfreiflächen lässt sich das Satzungsrecht nutzen. Dies muss unter Beachtung der jeweiligen Landesbauordnung geschehen, welche die Rechtsgrundlage zum Aufstellen solcher Satzungen bietet.
Satzung zur Herstellung von Einfriedungen
Einige Landesbauordnungen ermächtigen zum Erlass von Satzungen über die Herstellung sowie über die Art, Höhe und Gestaltung von Abgrenzungen und Einfriedungen. Da letztere auch eine schützende bzw. die Ableitung unterstützende Funktion bei Starkregenereignissen erfüllen können, bietet sich auch hier ein Ansatzpunkt für den Objektschutz, vorausgesetzt die Ableitung wird mit ausreichenden Retentionsmaßnahmen abgestimmt.
Unter Beachtung der jeweiligen Landesbauordnung kann festgelegt werden, welche Vorgaben zu nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken gemacht werden (z. B. zur Wasserdurchlässigkeit). Diese Vorgaben können bereits im Genehmigungsverfahren Beachtung finden.
Eine fundierte Beratung seitens der Kommune kann dazu beitragen, dass blau-grüne Maßnahmen auch im privaten Bereich umgesetzt werden. Die Stadt kann hier als Vorbild voran gehen und dies entsprechend vermarkten. Auch ist die Gründung einer Koordinierungs- / Beratungsstelle (ggf. in Kombination mit anderen Themen der Klimaanpassung) sinnvoll.
Durch Fördermittel können Anreize für GrundstückseigentümerInnen und Investoren geschaffen werden, Anpassungsmaßnahmen einzuplanen. In vielen größeren Städten gibt es bereits erfolgreiche Programme, die Entsiegelung und Begrünung auf privaten Grundstücken fördern.
In der Abwassersatzung müssen Kommunen die sog. gesplittete Abwassergebühr festsetzen. Hierbei wird nicht der Frischwasser-Maßstab für die Abwassergebühr veranschlagt. Grundstücke, auf denen Regenwasser zurückgehalten / versickert werden kann, werden prozentual von der Gebühr befreit. Dies kann ein weiterer Anreiz für die Umsetzung von blau-grünen Maßnahmen sein.
Beispiel: Niederschlagswasserbeseitigungskonzept in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind Städte und Gemeinden nach § 47 Abs. 3 LWG dazu verpflichtet, im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes auch die Niederschlagswasserbeseitigung zu betrachten. Dabei sind unter anderem Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung zu berücksichtigen. So bietet das sogenannte Niederschlagswasserbeseitigungskonzept die Möglichkeit, Entwässerung nachhaltiger zu gestalten und blau-grüne Infrastrukturen zu forcieren. Durch die geforderten regelmäßigen Fortschreibungen können Veränderungsprozesse regelmäßig aufgegriffen und für eine blau-grüne Stadtgestaltung genutzt werden (z. B. Umnutzung von frei werdenden Flächen). Mehr Informationen bieten die Seiten des LANUV.
Beispiel: Planerische Gestaltungsmöglichkeiten in der Bauleitplanung
Der Landkreis Görlitz hat für seine Kommunen im Rahmen des INTERREG-Projektes TEACHER-CE eine Übersicht über die planerischen Gestaltungsmöglichkeiten für blau-grüne Infrastrukturen erstellt: Die untenstehenden Informationen und Tabellen sollen den Kommunen helfen, die Möglichkeiten auszuschöpfen und eine effektive Überflutungs- und Hitzevorsorge zu erreichen. Die Grundlage für die Übersichten bildeten die Leitfäden
- Freie Hansestadt Bremen (Hrsg.) (o.J.): Merkblatt für eine wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung. Empfehlungen und Hinweise für eine zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung und eine Überflutungsvorsorge bei extremen Regenereignissen in Bremen. und
- Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. (Hrsg.) (2016): Leitfaden zur Starkregenvorsorge. Ein Nachschlagewerk für Kommunen der Metropolregion Nordwest. Delmenhorst.
Im Flächennutzungsplan kann die Kommune die städtische Entwicklung regeln und die bauliche Nutzung festlegen.
Norm im BauGB | Inhalte | Maßnahmen |
§ 5 Abs. 2 Nr. 2c | die Ausstattung des Gemeindegebiets […] mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen | – Retentionsraumsicherung und -erweiterung – Rückhalt von Niederschlagswasser in der Fläche |
§ 5 Abs. 2 Nr. 7 | die Wasserflächen, Häfen und die für die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen sowie die Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind | – Retentionsraumsicherung und -erweiterung
|
§ 5 Abs. 2 Nr. 5 | die Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe | – Retentionsraumsicherung und -erweiterung |
§ 5 Abs. 2 Nr. 9a | die Flächen für die Landwirtschaft | – Retentionsraumsicherung und -erweiterung |
§ 5 Abs. 2 Nr. 9b | Wald | – Retentionsraumsicherung und -erweiterung |
§ 5 Abs. 2 Nr. 10 | die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft | – Retentionsraumsicherung und -erweiterung – Rückhalt von Niederschlagswasser in der Fläche – Verringerung des Schadenspotenzials |
§ 5 Abs. 2 Nr. 4 | die Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, für Ablagerungen sowie für Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen | – Rückhalt von Niederschlagswasser in der Fläche |
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 | die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen), nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) sowie nach dem allgemeinen Maß der baulichen Nutzung; Bauflächen, für die eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist, sind zu kennzeichnen | – Rückhalt von Niederschlagswasser in der Fläche – Verringerung des Schadenspotenzials |
Kommunen haben verschiedene Möglichkeiten, wichtige Bausteine rechtsverbindlich im Bebauungsplan zu verankern. Die vorliegende Tabelle zeigt Festsetzungsmöglichkeiten hinsichtlich der Starkregenvorsorge auf.
BauGB | Inhalte | Maßnahmen |
§ 9 Abs. 1 Nr. 1-3 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden: | – Wahl von unempfindlichen bzw. verträglichen Nutzungen für durch Starkregen betroffene Teilbereiche, z. B. Grünflächen |
§ 9 Abs. 1 Nr. 10 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung; | – Freihaltung von Flächen zur (temporären) Retention oder zur Verdunstung von Niederschlagswasser |
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] die Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen; | – Sicherung von Flächen für Regenrückhaltebecken und -flächen |
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, Naturerfahrungsräume, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe | – Festsetzung von Grünflächen können mit einer bestimmten Zweckbestimmung, bspw. einer (temporären) Regenwasserrückhaltung |
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden: | – Festsetzung von wasserwirtschaftlichen Flächen für wasserrechtliche Gegenstände |
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft | – Festsetzungen zum Ausgleich von Eingriffen in die Natur |
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastenden Flächen | – Festsetzung von Notwasserwegen, damit die bei Starkregenereignissen auftretenden Abflussspitzen in weniger gefährdete Bereiche geleitet werden können |
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, einschließlich von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wobei die Vorgaben des Immissionsschutzrechts unberührt bleiben; | – Die Festsetzung solcher Bereiche verfolgt vor allem das Ziel, durch Abstände einen erforderlichen Schutz zu erreichen. |
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 | Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon sowie für Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald festgesetzten Flächen | – Festsetzungen können sich auf den gesamten Geltungsbereich oder auf Teilbereiche beziehen |
§ 9 Abs. 3 Satz 1 | Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann auch die Höhenlage festgesetzt werden. | Da Abflüsse durch kleinste Höhenunterschiede in die eine oder andere Richtung gelenkt werden können, kann es für einen geordneten Notabfluss von Regenwasser sinnvoll sein, genaue Vorgaben zur Geländeoberfläche zu machen. Zudem kann die Höhenlage der Erschließungsstraßen und des Geländes so festgesetzt werden, dass sie über dem zu erwartenden Wasserspiegel bei Starkregen liegt. Ferner besteht im Sinne der Überflutungsvorsorge die Möglichkeit, die Erdgeschossfußbodenhöhe verbindlich über dem geplanten Straßenniveau festzusetzen. |
§ 9 Abs. 3 Satz 2 | Festsetzungen nach Absatz 1 für übereinanderliegende Geschosse und Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen können gesondert getroffen werden; dies gilt auch, soweit Geschosse, Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche vorgesehen sind. | Mit dieser Festsetzung lassen sich geschossweise oder im Verhältnis zur Geländeoberfläche Gebäudenutzungen festsetzen bzw. ausschließen. Somit können bei einem erhöhten Überschwemmungsrisiko bspw. Aufenthaltsräume in Kellerräumen ausgeschlossen werden. |
§ 9 Abs. 5 Nr. 1 | Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet werden: | Diese Kennzeichnungen haben keine rechtliche Verbindlichkeit, sondern erfüllen eine reine Warnfunktion. Sie sollen Behörden sowie Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer im Rahmen von nachfolgenden Genehmigungsverfahren auf mögliche Gefahren, z. B. infolge von Starkregenereignissen, hinweisen. Auf diese Weise kann eine angepasste bauliche Nutzung befördert werden. |
Beispiel: Klimafreundliche Vorgartengestaltung
Die Stadt Nettetal ist darum bemüht, die naturnahe Gestaltung von Vorgärten privater Grundstücke voranzutreiben. Hierzu gibt es in den neueren Bebauungsplänen die Vorgabe, nicht überbaute oder versiegelte Grundstücksbereiche gärtnerisch zu gestalten und als solche zu erhalten. Eine Gestaltung von Steingärten ist dabei nicht zulässig. Mit diesem Ansatz soll das Mikroklima der Stadt verbessert werden und die Artenvielfalt erhalten bleiben. In Neubaugebieten finden zudem Vorgartenwettbewerbe statt, die einen Anreiz für eine klimafreundliche Gestaltung setzen sollen.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der Stadt.
Relevante Projekte
Leipziger Blau-Grün
Das Projekt „Leipziger BlauGrün“ befasst sich mit der Planung und Forschung im Neubauquartier. Im Fokus steht hierbei die Entlastung des zentralen Abwassersystems, die Verbesserung der Energieeffizienz und des Mikroklimas, sowie ein resilientes Starkregenmanage-ment. Die gewonnenen Erkenntnisse werden direkt im Modellquartier „Eutritzschen Freiladebahnhof“ erprobt und angewendet.
Projekt SAMUWA
Bei SAMUWA handelt es sich um ein Verbundforschungsvorhaben, welches Kommunen und Entwässerungsbetriebe bei einer anpassungsfähigen Bewirtschaftung des stadthydrologischen Gesamtsystems unterstützt. Dazu werden bestehende Entwässerungssysteme überdacht und weiterentwickelt.
Projekt KLAS
KLimaAnpassungsStrategie Extreme Regenereignisse (KLAS) hatte heftige Regenfälle in Bremen im Jahre 2011 zum Anlass. Schon damals wurden mehr integrative Prozesse gefordert, um die Starkregenvorsorge und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe meistern zu können. Die Erkenntnisse des Projekts dienen neben der Stadt Bremen selbst auch anderen Kommunen.